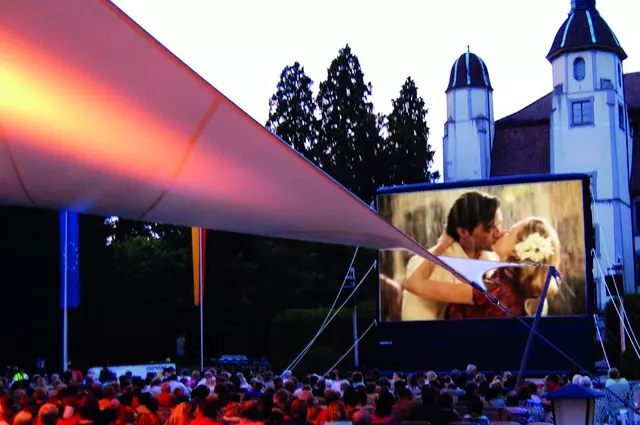Hauptbereich
Herzlich willkommen zur Wechselausstellung Nr. 6 – „450 Jahre: Die Brücke aus Holz“
Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2023 erinnert das Tourismus- & Kulturamt im Hochrheinmuseum Schloss Schönau an eines seiner bedeutendsten Bauwerke: Die Holzbrücke.
Good News: Wir gehen in die Verlängerung bis zum 31. Mai 2024!
Wechselausstellung Nr. 6 - "450 Jahre: Die Brücke aus Holz"
Die längste überdachte Holzbrücke Europas (204 m) ist eines der Wahrzeichen der Stadt Bad Säckingen. Die Brücke hat bereits viel in ihrer 450-jährigen Geschichte erlebt – aber auch die Menschen haben ihre ganz eigenen Geschichten mit ihr. Diese Geschichten und ihre Historie werden in einer Ausstellung anlässlich ihres Jubiläums 2023 beleuchtet. Ergänzung findet der historische Rückblick, in der auch die Wandlung der Brücke im Lauf der Jahrhunderte eine Rolle spielen wird, in der Präsentation von Gemälden. Das Hochrheinmuseum beherbergt in seinen Depots, zu diesem auch heute noch beliebten Motiv, zahlreiche Bilder regionaler Künstler. Die Wechselausstellung erfährt eine Bereicherung durch Kunstwerke, die unter dem Motto „Holzbrücke neu gesehen“ von Schüler*innen im Rahmen eines Schulwettbewerbs gestaltet wurden. Hier liegt der Fokus auf junger Kreativität.
Diese Schätze, darunter auch ausgewählte Leihgaben von Bürger*innen der Region, sowie die Kunstwerke der Schüler*innen, gehören zu den Highlights der Ausstellung. Diese ist vom 01.11.2023 bis zum 31.05.2024 als Wechselausstellung Nr. 6 in den Räumen des Hochrheinmuseum Schloss Schönau zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen:
ab April: Do, Sa & So von 14 - 17 Uhr
Beachten Sie bitte, dass das Schloss Schönau nicht barrierefrei ist. Ein Teil der Kunstwerke des Wettbewerbs ist als Outdoor-Ausstellung im Schlosspark bis zum 17.3. unter dem Motto „Museum für Alle“ kosten- und barrierefrei zu sehen.
Beachten Sie bitte auch unsere gesonderten Schließtage:
24.03.2024 // 25.04.-28.04.2024 // 09.05.2024
Tipp: Brückenmodell
Das Modell der Holzbrücke (ca. 4 m) stammt von der Firma Balteschwiler. Es entstand für die Ausstellung “Brücken, Fähren, Furten” des Museums Schiff in Laufenburg (CH).
Seit 2023 ist es als Dauerleihgabe im Foyer des Bad Säckinger Kursaals - kosten- und barrierefrei - zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen.
Es ist ein Symbol für die nachbarschaftliche Zusammenarbeit.
Begleitprogramm zur Ausstellung
Die Wechselausstellung Nr. 6 umfasst ein Begleitprogramm aus Vorträgen zur Säckinger Holzbrücke und anknüpfenden Themen. Zudem bieten wir wieder das Säckinger Schlosshäppchen an. Hier handelt es sich um Kurzführungen (max. 30 Minuten) zu einem Thema der Ausstellung oder zu einem Exkurs-Thema. Dieses Format bietet Gelegenheit für den Dialog. Bald erfahren Sie auf dieser Seite mehr dazu.
03.11.2023, 18 Uhr - Vernissage, Grußwort & Apéro
Vorträge
14.12.2023, 19 Uhr - "Die Magdalenenflut von 1480 am Hochrhein" (Gerhard Krug), Eintritt: 3€/mit Museumspass frei
18.01.2024, 20 Uhr - Bad Säckingen und seine Brücken - die Holzbrücke" (Heidy Enderle), Eintritt frei
22.02.2024, 19 Uhr - "Die Geschichte der Rheinbrücken in Laufenburg" (Hannes Burger), Eintritt frei
07.03.2024, 19 Uhr - "Flößerei auf dem Rhein" (Jens Ohlsen), Eintritt frei
Säckinger Schlosshäppchen
26.11.2023, 15 Uhr
04.02.2024, 15 Uhr
Öffentliche Führungen
18.04. // 16.05.
jeweils um 14.30 Uhr, ca. 60 Minuten, Eintritt: 8€/6€ ermäßigt / 3€ Kinder
Finissage
31.05.2024, 18 Uhr - Abschlussveranstaltung mit Apéro, Eintritt frei
Weitere Infos zu den Veranstaltungen finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
Schulwettbewerb „Holzbrücke neu gesehen“
Anlässlich der Jubiläumsausstellung „450 Jahre: Die Brücke aus Holz“ hat der Fachbereich 4 - Bildung, Soziales, Tourismus und Kultur in Zusammenarbeit mit Frau Ricarda Hellmann (Rektorin, Werner-Kirchhofer-Realschule) einen Schulwettbewerb unter dem Motto „Holzbrücke neu gesehen“ ausgeschrieben. Teilgenommen haben verschiedene Schulen in Bad Säckingen - dabei waren die Klassenstufen 1. bis 10. Klasse, sowie der Leistungskurs der 12. Klasse. Im Fokus stand "junge Kreativität", die sich individuell im Rahmen der kulturellen Bildung mit der Holzbrücke auseinandersetzt. Es entstanden Gruppen- wie auch Einzelwerke, die die Wechselausstellung in Raum 1 bereichern. Auf dieser Seite präsentieren wir alle ausgewählten Kunstwerke, die im Schloss Schönau präsentiert werden.
Die Bildergalerie wird im Ausstellungszeitraum vom 1.11.23 – 31.3.24 stetig erweitert - alle Schüler*innen erhalten die Möglichkeit ihr Kunstwerk digital zu präsentieren.
Ausgewählte Kunstwerke der Rudolf-Graber-Schule
Idee: “Gesamtkomposition - Strukturen, geometrische Formen, Farben”
Bei diesem Kunstwerk steht Teamwork im Vordergrund. Die Aufgaben wurden nach Kompetenzen verteilt. Ein Schüler bekam beispielsweise die Aufgabe alles Runde, was nicht aus Holz ist, zu fotografieren.
Diese Blickpunkte wurden gemeinsam von allen Schüler*innen durch Überstempeln hervorgehoben. Aus vielen Fotos wurden 9 ausgewählt, Farben zugeordnet und zu einem Gesamtwerk arrangiert. Von klein, nach groß, sowie die Farbanordnung, war der gemeinsame Konsens. Vorgegeben wurde dabei der vertikale Verlauf der Holzmaserung.
Schüler*innen: Tasnim, Sofie, Nico, Jannik, Baraa, Cedrick, Massud, Enis, Ammar, Mostafa
Ausgewählte Kunstwerke der Werner-Kirchhofer-Realschule
Die Teilnehmer*innen der Klassenstufen 5 bis 10 haben Werke zu verschiedenen Themen eingereicht:
- “Holzbrücke of fame” (Collage, Mix)
- Holzbrücke in surrealistischer Szene
- Holzbrücke in ungewohnter Umgebung
- Postkarten - 450 jähriges Jubiläum
- Holzbrücke im Sonnenuntergang
- Bleistift- und Kohlezeichnungen, Bilder mit Wasserfarben etc.
Die Werner-Kirchhofer-Realschule präsentiert in einer eigenen, internen Schulausstellung weitere Kunstwerke, die im Zuge des Wettbewerbs entstanden sind.
Ausgewählte Gesamtkomposition des Scheffelgymnasiums
Kunstwerke der Kursstufe 12 des Scheffelgymnasiums
Idee: Wir verbinden mit der Holzbrücke die Materialien Holz und Wasser. Sie werden in den Kunstwerken in den Fokus gerückt. Eine besondere Perspektive und/oder persönliche Ansicht verleihen dem Bild Originalität.
Technik: Fotografie
Die Fotografie wird auf Holz übertragen, was einerseits einen Bezug zur Holzbrücke herstellt und andererseits Treibholz aus dem Rhein assoziieren kann. Die Struktur des Holzes schimmert durch und nimmt gestalterisch Einfluss auf die Fotografie.
Durch die Technik der Fotoübertragung auf das Holz entsteht der Vintage-Stil. Der Eindruck, dass die Bilder alt wirken und damit auf das Vergehen der Zeit verweisen, nimmt Bezug auf das Alter und die lange Geschichte der Brücke.
Motiv: Rheinwasser, Rheinufer und/oder Holzbrücke
Teilnehmer*innen: Katharina, Pia, Lea, Ceren, Valentin, Lena, Dominik, Louis, Svenja, Kaylin, Elena, Annika, Rojin, Jeremy
Weitere Kunstwerke des Wettbewerbs
Hier präsentieren wir weitere Kunstwerke von Teilnehmer*innen der Werner-Kirchhofer-Realschule, die es nicht in die Endauswahl geschafft haben, aber dennoch sehenswert sind.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Schüler*innen, die ihre Ideen, Impressionen und Gedanken in ihren Bildern visualisiert haben. Die eingebrachte Kreativität und die Auseinandersetzung mit einem der bedeutendesten Bauwerke Bad Säckingens ist zugleich Weg und Ziel gewesen.
In diesem Gemeinschaftsprojekt - zwischen den Schulen und dem Sachgebiet Tourismus und Kultur - konnten wir Teilhabe an kultureller Bildung ermöglichen und zugleich eine wertvolle Bereicherung der Wechselausstellung im Hochrheinmuseum Schloss Schönau erleben.
Herzlichen Dank auch an die Lehrer*innen sowie mitwirkende Kunst- und Kulturschaffende.
Ein Blick in die Bildergalerie lohnt sich - für eine größere Ansicht, einfach auf's Bild klicken!
Die Ausstellung
Wechselausstellung Nr. 6 - "450 Jahre: Die Brücke aus Holz"
Raum 2 und 3 behandeln die Geschichte der Säckinger Holzbrücke, von den ersten schriftlichen Erwähnungen der ursprünglichen Brücke bis ins Heute.
Ergänzung findet der historische Rückblick in der Präsentation von Gemälden, darunter auch Leihgaben von Bürger*innen der Region. Das Hochrheinmuseum beherbergt in seinen Depots, zu diesem auch heute noch beliebten Motiv, zahlreiche Bilder regionaler Künstler. Das Stadtarchiv unterstützt die Ausstellung mit zahlreichen historischen Fotografien.
Geschichte & Geschichten zur Holzbrücke
Die Brücke hat bereits viel in ihrer 450-jährigen Geschichte erlebt – aber auch die Menschen haben ihre ganz eigenen Geschichten mit ihr. Menschen von hier, aber auch aus der Ferne, haben sich mit ihren Gedanken und ihrer Geschichte an der Ausstellung beteiligt. Die Geschichte der Brücke und die Geschichten der Menschen zeigen, dass die Brücke durch alle Zeiten bis ins Heute bedeutungsvoll ist.
Wir bedanken uns herzlich für die Geschichten, die Fotos und den Dialog. Wir suchen weiter - wenn Sie etwas zu unserer Geschichtensammlung beitragen möchten, dann schicken Sie uns diese per E-Mail.
Historischer Rückblick: Die Entstehung der Holzbrücke
Eine undurchschaubare Geschichte
Im Lauf der Jahrhunderte war die Brücke zwischen dem linken und dem rechten Rheinufer vieles: die Verbindende, die Zerstörte, die Grenze, die Beharrliche, die Betroffene, die Eindrucksvolle, die Denkmalgeschützte und nicht zuletzt ist sie heute mit ihren 204 m Länge die längste überdachte Holzbrücke Europas. Die Säckinger Holzbrücke verbindet seit Jahrhunderten, ihr Alter jedoch lässt sich nur schwer verorten. Erstmals erwähnt wurde eine Brücke 1272 (Colmarer Annalen), wobei es sich hier wohl um die steinerne Brücke handelt. Die Säckinger Rheininsel besaß zwei Rheinbrücken, eine steinerne, die das nördliche Hinterland mit der Insel, sowie die hölzerne Brücke, die die Insel mit den linksrheinisch gelegenen wirtschaftlich und politisch bedeutenden Besitzungen des Damenstifts - mit dem Fricktal (bis 1801) und dem heutigen Kanton Glarus (bis 1395) verband. Für die frühen Jahrhunderte fehlen die archivalischen Quellen, weshalb die Geschichte der Holzbrücke sich nur indirekt ermitteln lässt. Ob das Stift oder die Stadt Erbauer der Brücke war, lässt sich nicht sicher sagen. Im Jahr 1343 stritten die Stadt und das Damenstift um die Brückenhoheit. Der Streit konnte durch Agnes von Ungarn geschlichtet, aber nicht entschieden werden. In der Folgezeit erscheint die Brücke aber als Eigentum der Stadt, denn diese tritt bei Reparaturen und Neubauten vornehmlich als Bauherr auf.
Die Ursprüngliche
Die ursprüngliche Brücke mit ihren hölzernen Pfeilern wurde immer wieder Opfer der Naturgewalten. Somit war die Stadt, deren Gründung im 12. Jahrhundert erfolgte, immer wieder vom wirtschaftlichen Hinterland links des Rheins abgeschnitten. Daher entschloss sich die Stadt um 1570 für den Neubau einer massiven Konstruktion mit 7 steinernen Pfeilern, die fortan den Naturgewalten besser trotzen sollten. Dies war die bedeutendste bauliche Veränderung in ihrer Lebensgeschichte - sie dauerte ganze 60 Jahre und begründete ihre heutige Gestalt.
Die Standhafte
In ihrer Geschichte zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert wurde sie in zahlreichen Kriegen zerstört - sie brannte mehrfach nieder. Die heute bestehende Konstruktion geht auf den Laufenburger Baumeister Blasius Baldischwiler zurück, der seine Arbeiten Anfang des 19. Jahrhunderts beendete. Die Säckinger Holzbrücke ist die einzige seiner Rheinbrücken, die heute noch Bestand hat. Zahlreiche Joche sind demnach schon über 200 Jahre alt. Im Jahr 1843 erfuhr die Brücke eine tiefergehende Erneuerung durch Fridolin Albiez von Niedergebisbach, der für das Tragsystem große Mengen von Eichen- und Fichtenholz verarbeitete. Er blieb dem Konstruktionsprinzip Baldischwilers treu, passte die Brücke jedoch neuen Anforderungen, wie dem aufkommenden Verkehr, an.
Exkurs
Die Steinerne
Die steinerne Brücke, an deren Stelle heute die Steinbrückstraße verläuft, verband bis ins Jahr 1830 die Säckinger Rheininsel mit dem nördlichen Ufer, auf der sich eine vorstädtische Siedlung befand. Diese ist schon für das frühe Mittelalter (9.-12. Jhd.) belegt. Erbaut wurde die Brücke vermutlich nach dem Ungarneinfall (926). Aus der Colmarer Chronik (1272) geht hervor, dass diese vom Stift errichtete Brücke aus Angst vor einem Angriff durch die Bürger zerstört und später wieder in ihrer ursprünglichen Form errichtet wurde. Dies sollte in den darauf folgenden Jahrhunderten immer wieder das Schicksal der verschiedenen Brücken am Hochrhein sein. Im Jahr 1303 ist sie abermals belegt. Auch sie erlitt beim großen Hochwasser von 1343 Teilschäden.
Die vorstädtische Siedlung im Norden
Zur mittelalterlichen Vorstadt im Norden der Rheininsel gehörten mitunter das Bad mit Thermalquelle, die Klosteranlage des Franziskanerinnenklosters sowie Mühlen und Eisenwerke, die sich entlang des Gewerbebachs erstrecken. Bis ins 17. Jahrhundert hinein gab es in Säckingen eine größere Anzahl von Eisenwerken, die Eisenverhüttung wurde 1431 erstmals schriftlich erwähnt. Zwei Hammerwerke gehörten Werner Kirchhofer, der heute vor allem als historisches Vorbild für Scheffels Trompetererzählung bekannt ist. Mit dem Niedergang der Erzförderung im Fricktal fand auch die Säckinger Eisenherstellung ein Ende, was 1682 urkundlich belegt ist. Im 19. Jahrhundert entstanden hier die industriellen Textilfabriken, die ein neuer und tragender Faktor im Wirtschaftsleben der Stadt wurden. Die Steinbrücke wurde vor dem Zuschütten des nördlichen Rheinarms (1830) nicht zerstört, daher befindet sie sich auch heute noch im Boden. Ein Kleindenkmal symbolisiert heute die Vergangenheit und die Gegenwart.
Allen Widrigkeiten trotzdend
Schicksalshafte Naturgewalten
Die erste Nachricht über die Zerstörung der Säckinger Holzbrücke durch Hochwasser stammt aus dem Jahr 1343. Betroffen waren auch die Brücken von Laufenburg, Rheinfelden und Basel. Der Stadt Säckingen wurde durch die Herzöge von Österreich der vorläufige Rheinzoll verliehen - Schiffe, die fortan die Brücke passierten, hatten eine Abgabe an die Stadt zu leisten. Dies sollte dem Wiederaufbau der Brücke dienen. Dass die Grundsteinlegung für den Gallusturm im Jahr 1343 erfolgte, dürfte nicht verwundern, er sollte an der Gabelung des Rheinarms zukünftig als Wellenbrecher dienen.
“[...] der Rhein durch die Bergwasser aufgebläht zu Säckingen mit allein dir Prucken hingestoßen, sunder viel Heusser und Gebäu erbärmlich hinweggerissen [...]. (1343, Stumps Chronik)
Der 1418 permanent eingeführte Rheinzoll durch Herzog Friedrich von Österreich verhalf der Stadt bei der teuren Instandhaltung. 1480 wurde die Säckinger Brücke durch die Magdalenenflut vollständig zerstört - ganze 11 von 12 Jochen wurden fortgerissen. Aus den Schuldverschreibungen jener Jahre geht hervor, dass der Neubau die städtischen Finanzen im Jahr 1443 (400 Gulden) und 1489 (870 Gulden) belastete.
Die Massive
Finanziell gebeutelt entschloss sich die Stadt um 1570 für den Neubau der Holzbrücke, die bis ins 19. Jahrhundert auf 7 steinernen Pfeilern den Naturgewalten besser Widerstand leisten sollte. Infolge der hohen Kosten dauerte der Bau lange 60 Jahre. In den Jahren 1570-1590 erfolgte der Bau von 4 Pfeilern auf der Stadt zugewandten Seite. Die anderen 3 Pfeiler am linken Rheinufer kamen erst in den Jahren 1620 bis 1630 dazu. Die Brücke erhielt ein neues hölzernes Tragwerk aus Eichenholz, da nun eine größere Spannweite der Joche möglich war. Damit war die Grundstruktur der heute bestehenden Brücke gegeben, wobei der 7. Pfeiler seit dem 19. Jahrhundert im Schweizer Ufer einbezogen ist.
Die Brücke wandelt sich
Die erste Brückenkapelle entstand wohl um 1570, die zweite folgte in den Jahren nach 1700. In dieser Zeit wurden auch die beiden Brückenheiligen Franz Xaver und Johannes Nepomuk aufgestellt. Die Statue des heiligen Johannes Nepomuk wurde im Jahr 1712 vom Chorherren Petrus Patrick Stuart gestiftet, der aus dem schottischen Königsgeschlecht der Stuarts stammte. Mit dem geplanten Bau des Rheinkraftwerks in den 1960er Jahren erlebte die Brücke eine tiefgreifende Veränderung. Im Zuge der Ausbaggerung des Rheinbetts wurde die Brücke nun auf 6 Betonpfeilern, teilweise bis zu einer Tiefe von 12 m, im Felsen verankert. Diese aufwendige und teure Maßnahme war notwendig, da das Rheinbett um bis zu 4 m abgesenkt wurde. Die einzigartige Brückenkonstruktion, die auf Baldischwiler zurückgeht, blieb dabei aber unangetastet.
Die Brücke in bewegten Zeiten
Die Zerstörte
Die massive Konstruktion auf steinernen Pfeilern sollte die standhafte Antwort auf die Naturgewalten sein. Aber auch sie teilt das Schicksal massiver Zerstörungen. Nun widerstand die Brücke zwar dem Hochwasser, wurde aber stiller Zeuge und Opfer zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen am Hochrhein. Bedroht wurde diese insbesondere durch die Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts.
Kriege und ihre Kosten
Während des 30jährigen Kriegs (1618-48) brannte die Brücke im Jahr 1633 ab. Für die folgenden 20 Jahre wurde eine Fähre genutzt. Ähnlich erging es ihr im Holländischen Krieg (1678). Abhilfe versprach abermals der Einsatz einer Fähre, die im Jahr 1686 - nach langem Rechtsstreit mit dem Säckinger Damenstift - in den Besitz der Stadt überging. Sie sollte noch bis 1699 die Stadt mit dem linken Rheinufer verbinden. Erst mit dem Friedensschluss von Rijswijk (1697) konnte die Brücke endlich wieder erbaut werden. Schwierig war wiederum die Finanzierungsfrage, die sich nur mit der Aufnahme einer Anleihe von 2000 Gulden beantworten ließ. Aus dieser Zeit stammt die erste namentliche Überlieferung des Baumeisters. Mit einer Balkeninschrift verewigt hatte sich „Meister Hannes Meyer Burger und Werchmeister der Stadt Seckingen Anno 1700“.
Das 18. Jahrhundert erforderte so manche Reparatur, in Folge derer die Stadt immer wieder zu Geldanlagen gezwungen war. Die vorderösterreichische Regierung schlug die finanzielle Unterstützung aus und empfahl den kostengünstigen Fährbetrieb. Da die Säckinger Brücke bis 1869 in kein Nah- oder Fernstraßennetz integriert war, sah man hier keinen dringenden Bedarf. Neue Anleihen führten 1785 zum Start des Wiederaufbaus durch Blasius Baldischwiler und den Mauermeister Zech. Auch diese Brücke wurde Opfer der Kriegswirren – beim Rückzug 1799 zündeten die Franzosen sie an. Baldischwiler, der in diesen unruhigen Zeiten bereits viele Brücken repariert hatte, errichtete für die Jahre 1800/1801 eine Notbrücke. 1810 wurden die Maßnahmen durch Baldischwiler mit der Reparatur von zwei Jochen beendet. Die Arbeiten, die mit der Vollendung der letzten beiden Joche 1810 abgeschlossen waren, kamen einem Neubau der Brücke in ihrer Holzkonstruktion gleich.
Die Brücke als Fluchtweg
Vor 175 Jahren sprang der revolutionäre Funke von Frankreich auf die badischen Demokraten und Republikaner über. Sie kämpften für «Freiheit, Wohlstand, Bildung für alle» - Zentrum der Bewegung war das Großherzogtum Baden mit seiner Grenze zur Nordwestschweiz. Dort fanden sie Unterstützung, Gleichgesinnte und Zuflucht.
Im April 1848 scharten die badischen Republikaner zahlreiche Freischärler in der Region um sich, um den Kampf mit den Regierungstruppen aufzunehmen. Am 19. April 1848 trafen Gustav Struve und Friedrich Hecker mit 600 Freischärlern in Säckingen ein. Als die Lage aussichtslos wurde, floh ein Gros ungehindert über die Holzbrücke nach Stein in die Schweiz. Die Flüchtlinge siedelten sich im Fricktal an und verbreiteten ihre demokratischen Gedanken über die Grenze hinweg. Der badischen Regierung waren diese Ereignisse ein Dorn im Auge. Sie forderte die Bekämpfung der politischen Flüchtlingsaktivitäten durch die Aargauer Regierung - ohne Erfolg. 1849 eskalierte die Situation, tausende Revolutionäre gingen ins schweizer Exil. Der Konflikt mit der Schweiz endete am 30. Juli 1849 mit dem Abzug der hessischen Truppen.
Ein explosives Geheimnis
Die Säckinger Holzbrücke mit ihren zahlreichen Geschichten, stand 2014 wegen ihres gefährlichen Geheimnisses im Fokus der Medien. Das Schweizer Militär hatte - unter höchster Geheimhaltung - in allen passierbaren deutsch-schweizer Grenzbrücken Sprengstoff deponiert, der jederzeit gezündet werden konnte. Sie dienten als permanente Sprengobjekte für den Verteidigungsfall - zunächst sollten sie im Zweiten Weltkrieg den Einmarsch deutscher Truppen verzögern. Seit den 1970er Jahren, zur Zeit des Kalten Krieges, richtete sich das Konzept in erster Linie gegen die Panzer des Warschauer Paktes.
“Erst jetzt ist die letzte Brücke zwischen Deutschland und der Schweiz Sprengstoff frei." (Der Spiegel, Herbst 2014)
Die Desarmierungsarbeiten endeten am 16. Oktober 2014 an der denkmalgeschützten Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und der Schweizer Gemeinde Stein. Im Zuge der Sanierung wurden mehrere 100 kg Sprengstoff aus den beiden Pfeilern, die mit Klappe versehen sind, entfernt. Das TNT befand sich in 5 m hohen Kammern und hätte jederzeit mit einem Zünder versehen werden können.
Verbindung, Grenze und Fluchtweg
Die Holzbrücke war die meiste Zeit die “Verbindende”, denn der Raum links und rechts des Rheins hat eine gemeinsame Kulturgeschichte. 1801 erklärte Napoleon den Rhein zur Grenze - die Brücke wurde im Staatsvertrag von 1808 offiziell zu dieser. Dies änderte nichts an den Besitzverhältnissen, die Brücke blieb in ihrer gesamten Länge im Besitz der Stadt Säckingens. Bis zum Beginn der badischen Revolution 1848 existierte die Grenze am Hochrhein viel mehr auf der Landkarte als in den Köpfen der Menschen. Sie diente den Revolutionären der badischen Revolution 1849 als verbindender Fluchtweg ins schweizer Exil. Von dort verbreiteten sie ihre liberalen Gedanken, wohl wissend, dass die Schweizer sie nicht an die Preußen ausliefern würden. Letztere bewachten die Grenze bis ins Jahr 1852 hinein streng. Erst wurde den Menschen am Hochrhein tatsächlich bewusst, dass der Rhein zwischen Bodensee und Basel zwei grundsätzlich unterschiedliche politische Systeme voneinander trennte.
Kriegerische Zeiten
Während des 1. Weltkriegs (1914-18) war die Brücke abgeriegelt. Dennoch trafen sich die Soldaten beider Nationen gelegentlich auf einen “Schwatz”, was in Fotografien belegt ist. Ab 1933 verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Säckingen und dem Fricktal nach und nach. Forderungen wie die des badischen Reichsstatthalters Robert Wagner (Alemannentag, 20. August 1933), der den “Anschluss” der deutschsprachigen Schweiz an das deutsche Reich forderte, schürte das Misstrauen gegenüber den Deutschen. Auf den Kriegsausbruch 1939 reagierte die Schweiz mit der Aufstellung von Panzerbarrikaden in Stein. 1944 wurde der Säckinger Brückeneingang mit Holzlatten versperrt und mit einer Tür versehen. Legale Grenzübertritte gehörten zur Ausnahme. Nach dem Kriegsende 1945 wurde der Grenzübergang streng von der französischen Besatzungsmacht überwacht.
Aus den Erinnerungen des ehemaligen Stadtrats Gustav Friebolin (Südkurier, 31.08.1984)
1914: Als die Holzbrücke mit Ausbruch des 1. Weltkrieges abgeriegelt wurde…
…waren die Säckinger Bürgerinnen und Bürger überrascht und aufgeregt.
…mussten links und rechts des Rheins Maßnahmen ergriffen werden zur Abwehr einer möglichen Bedrohung.
…lag bei der schweizer Landesverteidigung ein veralteter Befehl vor, im Kriegsfall die Brücke abzubrennen.
“Auf beiden Seiten gab es einen nicht geringen Aufruhr, als dieser Befehl bekannt wurde. Doch der beherzte schweizerische Standortkommandant hielt bei dem territorialen Heereskommando Rückfrage und bekam den beruhigenden Bescheid, dass die Order nicht mehr gültig sei. So wurde die alte ehrwürdige Brücke damals vor der Vernichtung bewahrt.”
Corona-Pandemie
Tief saß der Schock, als die Grenze am 16. März 2020 anlässlich der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit gesperrt wurde. Ganze zwei Monate war der Zugang zur Brücke mit einem Metallgitter versperrt. Eine einschneidende Zeit, die bei vielen BürgerInnen ein beklemmendes Gefühl hervorrief. Paare und Familien waren von einem auf den anderen Tag getrennt. Nach der Öffnung hielten viele Passanten inne, um die Botschaften zu lesen, die sich durch die Grenzschließung getrennte Liebende hinterlassen hatten. Wie glücklich waren auch die Familien, die sich nun wieder offiziell treffen durften - denn familiäre Beziehungen galten fortan als Grund für den Grenzübertritt. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte es einen derartigen Einschnitt nicht mehr gegeben. Heute herrscht Einigkeit darüber, dass man etwas Vergleichbares zukünftig nicht mehr erleben möchte.
Die Brücke heute
Die Geschichte und Geschichten der Brücke veranschaulichen, dass die Brücke vieles war und auch heute noch ist. Sie war immer eine Verbindung und ein wichtiger Lebensnerv der Stadt und zugleich ein Wahrzeichen für die Stadt (Bad) Säckingen. Zur Grenze wurde sie erst mit den napoleonischen Kriegen, deren Feldherr Napoleon den Rhein 1801 zur Grenze erklärte. Bis dahin waren die Menschen entlang des Hochrheins verbunden, schließlich gehörten und gehören sie einem kulturgeschichtlich gewachsenen Raum an. Sie war zeitlebens ein Symbol der Verbindung, denn einer Grenze. Die Sperrung der Brücke in kriegerischen Zeiten waren tiefe Zäsuren für die Menschen, die private, verwandtschaftliche und geschäftliche Kontakte pflegten und dabei tagein tagaus über die Brücke ans andere Rheinufer gelangten.
“Selten hat eine Brücke als Symbol der Verbindung zwischen Nachbarvölkern ihren Wert deutlicher dokumentiert als am Fridolinstag des Jahres 1946." (Zitat, Adelheid Enderle)
Spätestens die tiefe Betroffenheit über die Brückensperrung, die die Menschen während der Corona-Pandemie empfanden und zum Ausdruck brachten, spiegelt wider, wie tief die Verbindungen über den Rhein hinweg sind.
Zudem ist sie nicht nur die längste überdachte Holzbrücke Europas, sondern auch die letzte der von Blasius Baldischwiler erbauten Holzbrücken entlang des Hochrheins. Seine Konstruktion des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist heute noch in Teilen erhalten. Die denkmalgeschützte Brücke ist ein geschichtliches Monument und bezeugt die vergangene Kunst des Zimmermannshandwerks. Ihre Bedeutung lässt sich abschließend mit einem Zitat von Karl Braun verdeutlichen:
“Dieses Jahr feiert die Stadt Bad Säckingen mit der Schweizer Nachbargemeinde Stein und den Partnerstädten das Fest ihrer Brücke. Sicher werden die europäische Zusammenarbeit und die Wertegemeinschaft hervorgehoben. Gerade deshalb wäre es sinnvoll, ein Zeichen zu setzen und den Europa-Gedanken dauerhaft zu verankern. Nachdem Brücken aus Stein, Gusseisen und Stahl bereits zum Weltkulturerbe zählen bzw. Anträge in Vorbereitung sind, wäre es nur folgerichtig, überdachte Holzbrücken als bedeutende Werke der Zimmermannskunst ebenso zum Weltkulturerbe aufzunehmen, denn die geschichtsträchtigen Brücken gehören zu einer Zeitepoche des Brückenbaus und sind charakteristisch für die Kulturlandschaft.”(Zitat, Karl Braun, Badische Heimat März 2023)

Wir freuen uns, Sie im Hochrheinmuseum Schloss Schönau, im Schlosspark oder im Kursaal zu sehen.
Wenn Sie noch einmal auf das Jubiläumsjahr mit all seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und Events zurückblicken möchten, können Sie das auf unserer Landingpage tun.